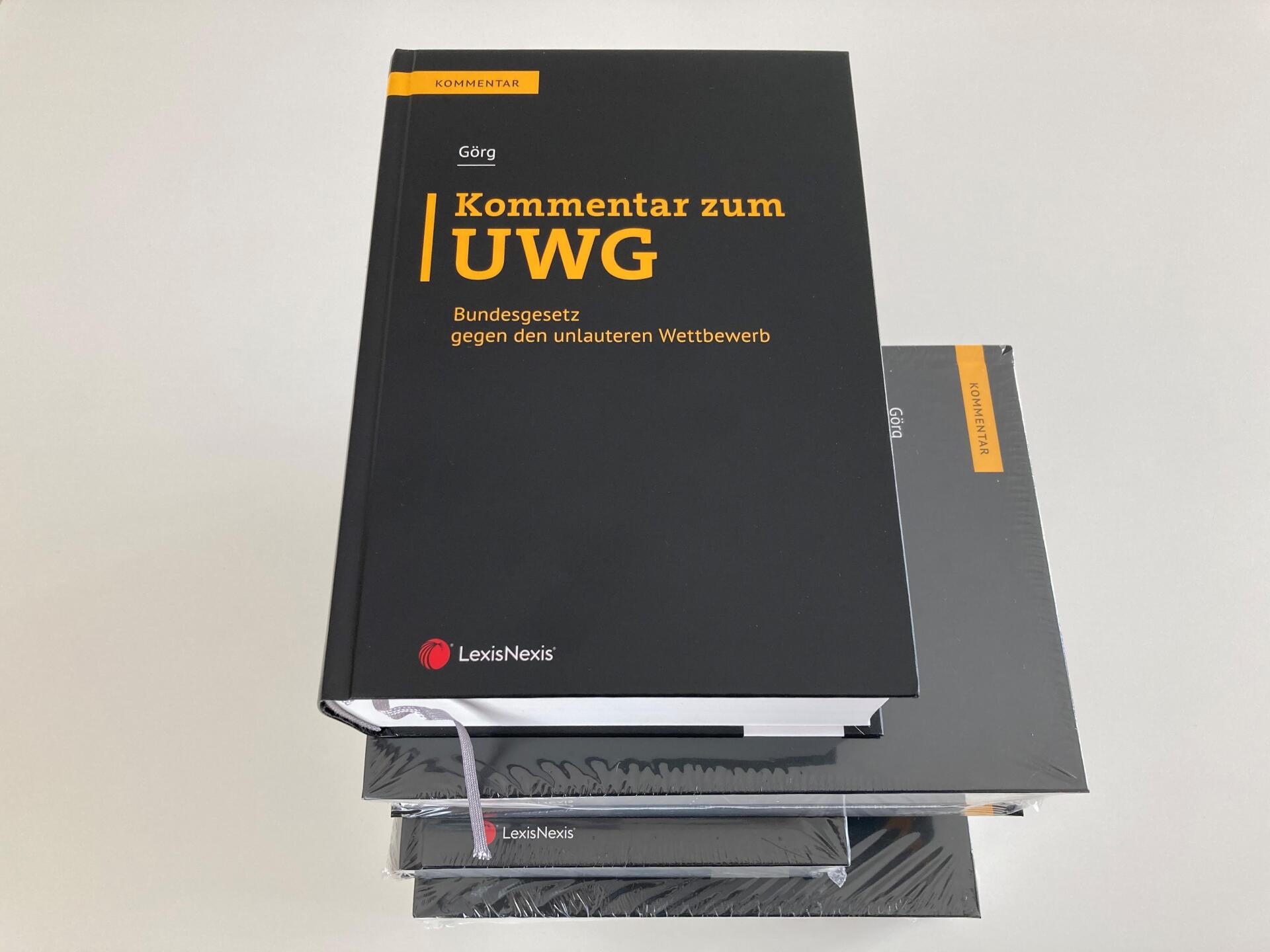Unlauterer Wettbewerb ist beinahe so allgegenwärtig wie das Ringen um Kunden an sich. Entsprechend hoch ist aber auch die Relevanz der einschlägigen Rechtsvorschriften. Was als unlauter bzw. Verstoß gegen die „berufliche Sorgfalt“ anzusehen ist, beurteilt sich nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Dabei spielen für das Wettbewerbsrecht im engeren Sinn, zumeist Lauterkeitsrecht genannt, auch das Immaterialgüterrecht (Markenrecht, Urheberrecht etc.) und das Kartellrecht eine wesentliche Rolle.
Die Bedeutung des Lauterkeitsrechts hat zuletzt sogar noch weiter zugenommen. Denn Mitte 2022 wurde auch hierzulande die sog. „Omnibus“-Richtlinie der EU scharfgeschalten. Somit ist nunmehr klargestellt, dass Verbraucher Schadenersatzansprüche auch auf das UWG stützen können. Zumindest für grenzüberschreitende Verstöße wurde außerdem ein Geldbußensystem analog zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO: bis zu 4% des Jahresumsatzes) statuiert.
Für Unternehmen, aber auch für diejenigen Anwaltskollegen, die nicht tagtäglich mit dem Wettbewerbsrecht befasst sind, habe ich unter den nachfolgenden Links einerseits Praxistipps zu den Themen "Unterlassung“, „Abmahnung“, „einstweilige Verfügung“ sowie „Urteilsveröffentlichung“, andererseits aber auch kurze Zusammenfassungen aktueller OGH-Rechtsprechung zum UWG bereitgestellt (jeweils ohne Gewähr):
PRAXISTIPPS
RECHTSPRECHUNG/NEWS
An der Stelle noch ein paar Erläuterungen zu besonders häufigen Fragestellungen:
Wann ist eine Geschäftspraktik irreführend?
Irreführend und damit unlauter ist eine Geschäftspraktik, wenn sie geeignet ist, Marktteilnehmer (Konsumenten, aber auch unternehmerische Abnehmer) zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie bei Kenntnis der wahren Sachlage nicht getroffen hätten. Das UWG will hier also dem Betroffenen eine informierte geschäftliche Entscheidung ermöglichen. Hierher gehören etwa Täuschungen durch Blickfang, „Segeln unter falscher Flagge“, weiters Irreführungen über die Verfügbarkeit, über Testergebnisse, über die Preisbemessung sowie über die Identität und Eigenschaften des Anbieters. Was sich nach wie vor nicht überall herumgesprochen hat: Nicht nur unrichtige, sondern auch bloß (wesentlich) unvollständige Informationen können den Tatbestand verwirklichen .
Wann ist eine Geschäftspraktik aggressiv?
Eine unlautere aggressive Geschäftspraktik ist anzunehmen, wenn unangemessener Druck auf den Marktteilnehmer ausgeübt wird, um ihn zu einer von ihm in Wahrheit nicht gewollten geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen. Zu denken ist dabeietwa an den werbemäßigen Einsatz von Autoritäten (zB Ärzte, Lehrer), die Ausnutzung von Unerfahrenheit oder Leichtgläubigkeit sowie von Angst oder Zwangslagen. In Betracht kommen hier aber auch Fälle der sog. „Wertreklame“ (Verkaufsförderungsmaßnahmen), etwa mit Koppelungsangeboten (inkl. Zugaben), weiters Rabatte, Preisausschreiben/Gewinnspiele, Kundenbindungssysteme sowie ein „moralischer Kaufzwang“ (zB bei Werbegeschenken).
Wann ist eine Behinderung anderer Mitbewerber unlauter?
Behinderungsmaßnahmen, die sich gezielt gegen bestimmte Mitbewerber richten, entsprechen nach der Judikatur keinesfalls den „anständigen Gepflogenheiten“. Dabei genügt es bereits, wenn die Behinderungsabsicht nur als ein „wesentliches Motiv“ fungiert. In Betracht kommen hier beispielsweise der Missbrauch von wirtschaftlicher Macht und Einfluss, Diskriminierungen, Bezugs- und Absatzbindungen, der Missbrauch von Machtmitteln der öffentlichen Hand, das sog. „Anzapfen“ von Lieferanten (etwa durch Supermarktketten), aber auch bestimmte Formen der Preisunterbietung, unberechtigte Abmahnungen, dass Ausspannen von Beschäftigten und Kunden, die Beeinflussung von Suchmaschinen sowie die pauschale Herabsetzung von Mitbewerbern. Unlauter ist aber auch eine sog. allgemeine Marktbehinderungv , mit der eine Bestandsgefährdung für den Wettbewerb als solchen einhergeht.
Was versteht man unter einer unlauteren Ausbeutung?
Ein lauterkeitsrechtlicher Schutz vor Ausbeutung kann speziell dann zur Anwendung gelangen, wenn kein immaterialgüterrechtlicher Schutz (mehr) besteht. Unterfallgruppen dieses sog. "ergänzenden lauterkeitsrechtlichen Leistungsschutzes" sind die vermeidbare Herkunftstäuschung, die unlautere Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung, die unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen, die Behinderung durch planmäßiges Nachahmen sowie die glatte Leistungsübernahme. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung kommt in Frage, wenn zwischen wettbewerblich eigenartigen Produkten bzw. Kennzeichen Verwechslungsgefahr besteht und eine andersartige Gestaltung (statt einer Nachahmung) zumutbar wäre. Eine glatte Leistungsübernahme ist insb. bei Einsatz technischer Vervielfältigungsmittel zu prüfen.
Ein „Vorsprung durch Rechtsbruch“ liegt worin?
Die Fallgruppe „Vorsprung durch Rechtsbruch“ betrifft Verstöße gegen generelle Normen, insbesondere auch des Verwaltungsrechts, oder aber gegen vertragliche Verpflichtungen. Vorausgesetzt ist ein "spürbarer" Wettbewerbsvorteil, der durchaus auch dann anzunehmen sein kann, wenn die betreffende generelle Norm (zB der Straßenverkehrsordnung) an sich keinen wettbewerbsregelnden Inhalt aufweist. Betroffene Mitbewerber sind hier also nicht auf ein Tätigwerden der Verwaltungsbehörde angewiesen, sondern können selbst Klage vor einem Zivilgericht einbringen. Aber Achtung: Kann der Beklagte eine immerhin „vertretbare Rechtsauffassung“ für sich in Anspruch nehmen , ist die Klage abzuweisen.
Kundenfang?
Ein unlauterer Kundenfang kommt insbesondere in folgenden Fällen in Betracht: "Laienwerbung", gefühlsbetonte Werbung, Lockvogelwerbung, oder Erlagscheinwerbung. Was Laienwerbung betrifft, ist allerdings das bloße Ausnutzen von persönlichen Beziehungen sowie die Gewährung einer Abschlusspremiere für den Anwerber noch nicht unlauter. Vielmehr sind dafür besondere Umstände erforderlich, wie etwa ein besonders aufdringliches Werben, eine Verschleierung des Werbecharakters, Fachunkundigkeit der Werber oder unverhältnismäßig hohe Provisionen. Auch gefühlsbetonte Werbung ist keineswegs automatisch unzulässig . Vielmehr ist eine solche suggestive Werbung selbst dann noch akzeptabel, wenn sie zB an Mitleid oder soziale Hilfsbereitschaft appelliert.
Inwiefern ist vergleichende Werbung zulässig?
Mittlerweile ist vergleichende Werbung zumindest bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen erlaubt. Dazu zählen unter anderem ein nicht-irreführender Charakter, eine hinreichende Substituierbarkeit der verglichenen Produkte, die Objektivität des Vergleichs, die Vergleichbarkeit der verglichenen Eigenschaften, das Unterbleiben einer unlauteren Rufausnutzung sowie des Herbeiführens von Verwechslungsgefahr. In der Entscheidungspraxis spielen auch vergleichende Produkttests durch Verbraucherschutzeinrichtungen und Unternehmerverbände eine wesentliche Rolle. Sie erfordern Neutralität, Objektivität und entsprechende Fachkunde.
Wann liegt eine unlautere Herabsetzung vor?
Eine unlautere Herabsetzung ist dann zu prüfen, wenn über einen Mitbewerber oder dessen Produkte Behauptungen aufgestellt oder verbreitet werden, die geeignet sind, dessen Betrieb bzw. Kredit zu schädigen. Anders als nach allgemeinen Zivilrecht liegt hier – außer bei „vertraulichen Mitteilungen“ – die Beweislast beim Äußernden. An ihm ist es also gelegen, vor Gericht die Richtigkeit seiner Behauptung nachzuweisen. Gelingt ihm dies nicht, kann er auch zum (öffentlichen) Widerruf verurteilt werden. Kann er andererseits darlegen, dass es sich um ein bloßes Werturteil handelt, welches lediglich Ausdruck seiner subjektiven Meinung ist, muss die Klage in der Regel scheitern.
Welchen Schutz bietet das UWG gegen den Missbrauch von Unternehmenskennzeichen?
Nach dem UWG kann auch gegen jemanden vorgegangen werden, der einen Namen, eine Firma, die besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder eines Druckwerks oder eine registrierte Marke in einer Weise benutzt, die Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung eines anderen Unternehmers hervorrufen kann. Dafür muss allerdings dem klägerischen Kennzeichen Unterscheidungskraft zukommen. Diese kann von Anfang an vorliegen oder aber erst durch sog. „Verkehrsgeltung“ erworben werden. In letzterem Fall können auch Unterscheidungsmittel ohne Namensfunktion wie zB "Austattungen" oder eine besondere Innengestaltung eines Lokals geschützt sein. Die in jedem Fall erforderliche Verwechslungsgefahr setzt Zeichenähnlichkeit ebenso wie Produkt- bzw. Branchenähnlichkeit voraus.
Inwiefern sind Geschäftsgeheimnisse geschützt?
Im Rahmen der Umsetzung der Know-how-Richtlinie der EU wurde ein neuer Unterabschnitt in das UWG eingefügt und damit der Begriff des Geschäftsgeheimnisses erstmals überhaupt gesetztlich definiert. Als wesentliche Neuerung setzt dessen rechtlicher Schutz voraus, dass auch „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ getroffen worden sind. Wo dies nicht der Fall ist, geht der Charakter als Geschäftsgeheimnis verloren. Zu den möglichen Schutzmaßnahmen gehören: Weitergabe nur an ausgewählte Personen, IT-Sicherheitsmaßnahmen, (sonstige) Zugangsbeschränkungen, Mitarbeitergespräche, Vertraulichkeitsbestimmungen in Dienstverträgen (auch über deren Ende hinaus). Ebenfalls überaqus bedeutsam: Bildet ein Geschäftsgeheimnis den Gegenstand eines Zivilverfahrens, muss es allein deshalb dort nicht mehr offengelegt werden (sog. "in camera"-Verfahren).
Was ist die „schwarze Liste“?
In einem eigenen Anhang zum UWG sind solche (irreführenden oder aggressiven) Geschäftspraktiken aufgelistet, die in jedem Fall – also insbesondere auch bei fehlender Relevanz für die geschäftliche Entscheidung – als unlauter anzusehen sind (sog. "per se"-Verbote). Hierher gehört etwa der Fall, dass den Verbrauchern schon vom Gesetz zugestandene Rechte als Besonderheit des betreffenden Angebotes präsentiert werden, weiters an Kinder gerichtete unmittelbare Kaufaufforderungen („Hol Dir …!“), die unrichtige Behauptung, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodex zu gehören, bestimmte Schneeballsysteme, die unrichtige Behauptung, ein Produkt könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen, die Beschreibung eines Produkts als „gratis“, „umsonst“ odgl., obwohl damit in Wahrheit sehr wohl weitergehende Kosten verbunden sind, sowie Fälle unbestellter Waren oder Dienstleistungen.
#Rechtsanwalt #Wettbewerbsrecht #Lauterkeitsrecht #UWG #Werberecht #Immaterialgüterrecht #Kartellrecht #Kommentar #Unterlassung #Schadenersatz #Urteilsveröffentlichung #einstweilige #Abmahnung #Unterlassungserklärung #Beratung